Eine dauerhafte stabile Währungsunion ohne den „Unterbau“ einer politischen Union ist ein historisches Novum oder – positiv ausgedrückt – ein „Alleinstellungsmerkmal“ der Europäischen Währungsunion. Den Vätern (und Müttern) des Euro – von Theo Waigel in Deutschland über Jean-Claude Trichet in Frankreich bis Azeglio Ciampi in Italien – war klar, dass eine solche Währungsunion nur dauerhaft überlebensfähig ist, wenn die fehlende politische Union durch einen festen und funktionsfähigen rechtlichen Rahmen und feste, vertrauenswürdige Institutionen ersetzt wird. Mit dem Maastrichter Vertrag und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt haben sie diesen Rahmen geschaffen, der nach den Erfahrungen der Staatsschulden- und Bankenkrise seit 2007 einer Schärfung und Ergänzung (vor allem durch Regeln einer vorbeugenden Staatenrestrukturierung) bedarf, aber im Grunde nach wie vor der einzige Weg für eine dauerhaft stabile Währungsunion ist.
Dieser Rahmen bestand nach der Erkenntnis der „Gründergeneration“ und besteht auch heute darin, für die fehlende politische Union in den für die Währung zentralen Politikbereichen (vor allem Wirtschafts- und Finanzpolitik mit Ausstrahlungen in die Sozial-und Rechtspolitik) einen Ausgleich zu schaffen. Das sicherten sie durch ein festes Regelwerk von Budget-Restriktionen, zum Beispiel das Verbot übermäßiger Staatsverschuldung, Art. 126 im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), und einer Absicherung der finanziellen Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten (keine monetäre Staatsfinanzierung, Art. 123 AEUV; keine Übernahme von oder Haftung für Staatsschulden eines anderen Mitgliedstaats, Art. 125 AEUV). Die finanzielle Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten und die Absage an Risiko- und Haftungsverlagerung („moral hazard“) auf Partnerstaaten ist eine zentrale Erfahrung föderaler staatlicher Ordnungen wie der Vereinigten Staaten von Amerika oder der Schweiz, die sich dadurch historisch als stabil erweisen konnten.
Finanzielle Eigenverantwortung
In der Europäischen Währungsunion sollte neben dem Stabilitätspakt als „öffentlichem Kontrollmechanismus“ die finanzielle Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten („no bail out“-Regel) als ein „marktwirtschaftlicher Kontrollmechanismus“ wirken, das Vertrauen der Märkte und Bürger in die Solidität der Mitgliedstaaten sichern und über „Marktdisziplin“ einen Druck in Richtung einer „Flexibilität für Reformen“ ausüben.
Eine solche Flexibilität für Reformen zur Sicherung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten ist eine notwendige Voraussetzung für das Gelingen einer Währungsunion. In ihr fehlt ja definitionsgemäß die Möglichkeit, Unterschiede in der preislichen Wettbewerbsfähigkeit durch externe Auf- und Abwertungen auszugleichen; sie muss durch die Bereitschaft zur Anpassung der „internen (realen) Wechselkurse“, also von Löhnen und Preisen und letztlich allen die Wettbewerbsfähigkeit bestimmenden Faktoren (einschließlich der Effizienz des öffentlichen Sektors und Gerichtsbarkeit sowie der Infrastruktur) ersetzt werden.
Diese grundlegenden Erkenntnisse über die Voraussetzungen einer Währungsunion ohne politische Union, die der Gründergeneration klar vor Augen waren, sind in den letzten Jahren zunehmend in Vergessenheit geraten oder bewusst verdrängt worden. In den aktuellen „Reformkonzepten“, sowohl auf europäischer Ebene (zum Beispiel „Fünf Präsidenten-Bericht“, Vorschläge von EU-Präsident Jean-Claude Juncker) spielen sie genauso wenig eine Rolle wie in den Vorschlägen von Mitgliedstaaten wie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.
Kein abgestimmtes deutsches Konzept
Von deutscher Seite gibt es leider – trotz zahlreicher Vorschläge (Bundesbank, Sachverständigenrat, ifo-Institut) – bisher kein abgestimmtes Konzept für die Weiterentwicklung der Währungsunion, wenn man einmal von einer Weiterentwicklung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu einem „Europäischen Währungsfonds“ absieht, dessen Einzelheiten, Chancen und Risiken in der Öffentlichkeit bisher nicht näher diskutiert wurden.
Das Hauptrisiko dieses Vorschlags besteht jedenfalls darin, dass im „Windschatten“ der scheinbar nebensächlichen Namensänderung in „Europäischer Währungsfonds“ die geltenden Abstimmungsregeln des ESM geändert werden, nach denen für das Stimmengewicht die Kapitalbeteiligung maßgeblich ist und Deutschland mit einem Kapitalanteil von knapp 27 Prozent und einem Quorum von 85 Prozent selbst im Dringlichkeitsverfahren bei Krisen nicht überstimmt werden kann. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings in seiner Entscheidung zum ESM vom 18. März 2014 festgelegt, die „Vetoposition Deutschlands“ müsse „auch unter geänderten Umständen erhalten bleiben“.
Vertrauen der Bürger muss erhalten bleiben
Das Ergebnis der im nächsten halben Jahr anstehenden Verhandlungen zur Weiterentwicklung der Währungsunion wird sicherlich ein Kompromiss sein, in dem sich „deutsche Vorstellungen“ nicht 100-prozentig wiederfinden. Es kommt aber darauf an, dass auch Maßnahmen beschlossen werden, die die entscheidenden „Testfragen“ für eine langfristige Stabilität der Währungsunion bestehen:
- Stärkt ein Vorschlag die finanzielle Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten?
- Erhöht er die Marktdisziplin?
- Schafft er Anreize zur Regelbefolgung?
Dies gilt zum Beispiel für einen schrittweisen Abbau der regulatorischen Privilegien für Staatsanleihen; dies gilt für eine regelgebundene, dass heißt automatische Prolongation von Staatsanleihen im Krisenfall (also die Inanspruchnahme außerordentlicher Kredite des ESM oder künftiger Sonderfonds); dies gilt für die Einschaltung einer unabhängigen Stelle (ESM) für die Beurteilung der Befolgung des Stabilitätspakts; dies gilt nicht zuletzt für die Unterlegung von Krediten an andere Mitgliedstaaten (einschließlich des Target-Kredits jenseits bestimmter Grenzen) durch valide Sicherheiten. Bei allen diesen Vorschlägen geht es letztlich darum, das oberste Gut Europas zu erhalten: das Vertrauen der Bürger in das Funktionieren seiner Institutionen und in die Gerechtigkeit seiner Regeln und Verfahren.
Eine kürzlich erfolgte Untersuchung der EZB zur Entwicklung der „realen Konvergenz in der Eurozone“ zeigt eindrucksvoll: Den größten Vorteil von der Währungsunion und den höchsten Wachstumsgewinn relativ zum Euro-Durchschnitt hatten die Länder, die sich an die ökonomischen und finanziellen Spielregeln der Währungsunion gehalten haben. Das sind etwa die baltischen Staaten oder Spanien, Irland sowie die Slowakei bei Überwindung der Krise. Dahingegen hatten Staaten, die versuchten, die finanziellen Regeln zu umgehen oder umzuinterpretieren (Italien, Griechenland) die höchsten Wachstumseinbußen relativ zum Durchschnitt des Euroraums.
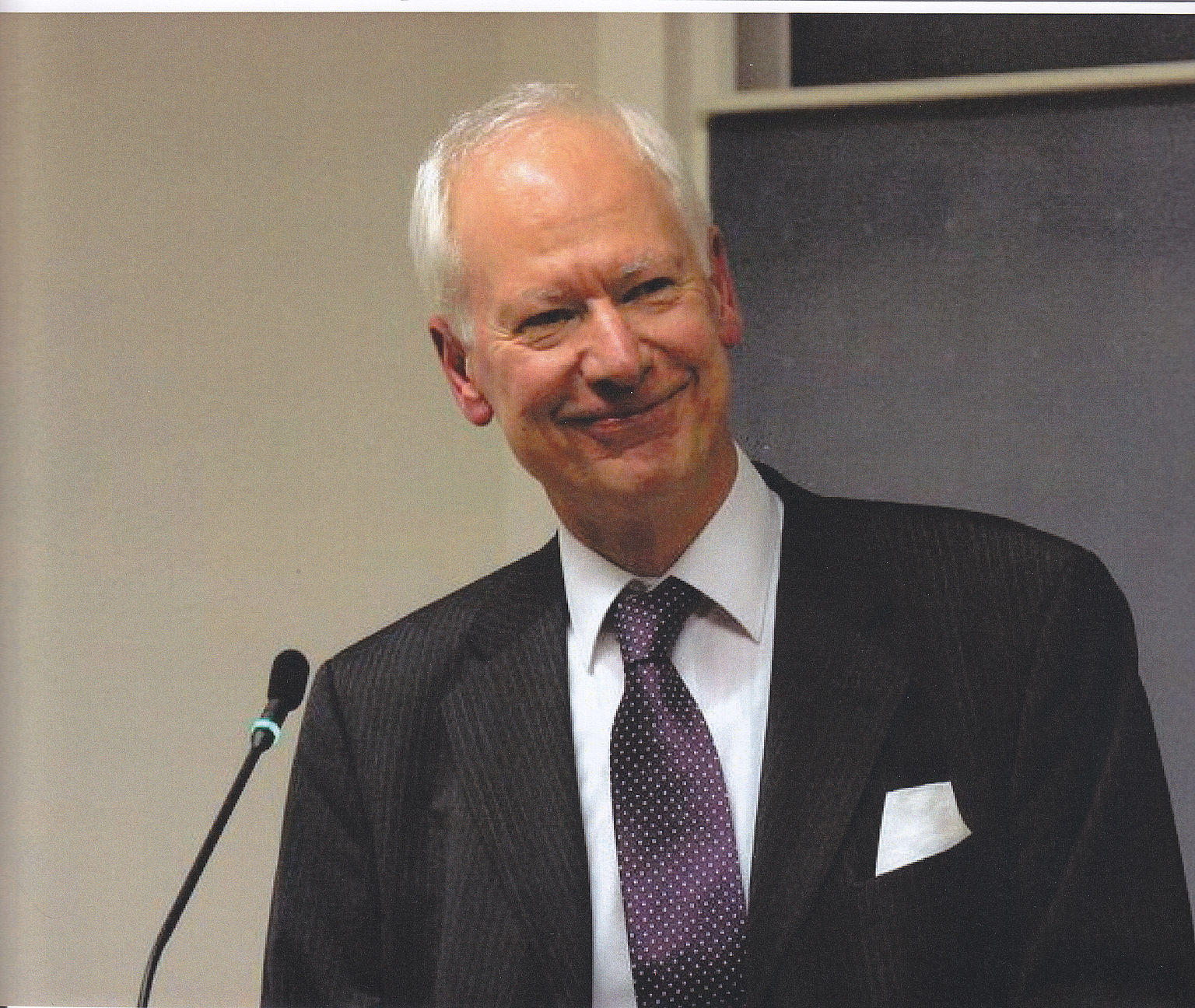
Der gebürtige Augsburger Prof. Franz-Christoph Zeitler (69) war von 2006 bis 2011 Vizepräsident der Deutschen Bundesbank und Vertreter des Präsidenten im EZB-Rat.

